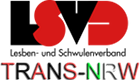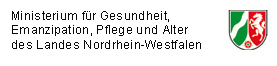Zusammenfassung der gegenwärtigen Rechtslage
Die spezielle Situation Transsexueller berührt zahlreiche Rechtsgebiete. Besonders für die Transition wichtig ist natürlich das Transsexuellengesetz, das i.w. namens- und personenstandsrechtliche Fragen regelt. Weiterhin berührt sind regelmäßig Medizin/Sozialrecht, Arbeitsrecht und auch datenschutzrechtliche Aspekte.
Transsexuellengesetz
Ein Antrag von Abgeordneten der SPD/ FDP aus dem Jahre 1976 (Bundestagssache 7/4940) und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von 1978 (1 BvR 16/72) führten dazu, dass das Transsexuellengesetz (TSG) 1980 vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde und am 1. Januar 1981 in Kraft trat.Seine Intention ist es, Menschen, welche eine von ihrem bei der Geburt festgestellten Geschlecht abweichende Identität haben, die Möglichkeit zu eröffnen, in der passenden Geschlechtsrolle leben zu können. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied 2002 im Fall Goodwin vs U.K. einen post-op-transsexuellen Menschen als dem neuen Geschlecht zugehörig anzuerkennen (vgl. NJW-RR 2004, 289 Rn89-93).
Nach mehreren Entscheidungen des BVerfG ist eine Reform des TSG überfällig geworden.
-
BVerfG 1 BvR 938/81 zur Altersgrenze bei der Personenstandsänderung
-
BVerfG 1 BvL 38/40, 43/92 zur Altersgrenze bei der Vornamensänderung
-
BVerfG 1 BvL3/03 zum Wegfall des geänderten Vornamens bei Heirat
-
BVerfG 1 BvL 1/04, 12/04 zur Anwendbarkeit des TSG für Ausländer
-
BVerfG 1 BvL 10/05 zum Erfordernis der Ehelosigkeit für die Personenstandsänderung
-
BVerfG 1 BvR 3295/07 zum Erforderins der geschlechtsangleichenden OP zur Personenstandsänderung
-
BVerfG 1 BvR 2027/11 zur Aussetzung der Verfahren bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber
a) Das Verfahren gemäß § 4 TSG
Es unterliegt der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), die Beteiligten werden als Verfahrensbeteiligte (Antragsteller) und nicht als „Kläger bzw. Beklagte“ bezeichnet. Es besteht kein Anwaltszwang und die Verhandlungen sind nicht öffentlich. Entscheidungen ergehen durch Beschluss oder Verfügungen, das Gericht muss von Amts wegen ermitteln. Dies bedeutet, dass in den meisten Fällen im Rahmen eines Prozesskostenhilfeverfahrens eine Beiordung eines Anwalts abgelehnt wird. Die Beiordnung muss dann besonders begründet werden.
Man kann in dem Antrag seine Wunschgutachter benennen. Das Gericht ist zwar nicht gezwungen diese zu nehmen wird es aber in der Regel tun.
Viele Verfahren nach TSG laufen über Prozesskostenhilfe (PKH). Je nach den wirtschaftlichen Verhältnissen wird diese mit oder ohne Ratenzahlung bewilligt.
aa) Altersgrenze: Das TSG konnte ursprünglich nur von Personen von über 25 Jahren in Anspruch genommen werden. Dies wurde vom BVerfG für verfassungswidrig (für die Personenstandsänderung im Jahr 1982: BVerfGE 60, 123, für die Vornamensänderung im Jahr 1993: BVerfGE 88, 87) erklärt und infolgedessen wurden die diesbezüglichen Vorschriften nicht mehr angewendet,der Gesetzgeber änderte das TSG zunächst nicht. Erst der im Jahr 2007 geänderte § 1 TSG enthält keine entsprechende Einschränkung mehr.
Dennoch kann es bei Gerichten Probleme geben, wenn die antragstellende Person sehr jung ist.
bb) Rechtsstellung von Ausländern: Der Anwendungsbereich des TSG war zunächst auf Deutsche im Sinne des Grundgesetzes (GG) und anerkannte Asylberechtigte eingeschränkt. Das BVerfG (1 BvL 1 und 12 /04, vgl. FamRZ 2006, 1818) entschied im Jahr 2006, dass diese Einschränkung nicht mit dem Allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG und dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG – also der Werteordnung des GG – vereinbar ist.
Im Zuge der Änderung des Passgesetzes (PassG) erweiterte der Gesetzgeber deswegen 2007 den Geltungsbereich des TSG auf jene Ausländer, deren Heimatrecht keine mit dem TSG vergleichbare Regelung kennt.
Die Neuregelung des § 1 TSG bewirkt allerdings nicht, dass die Namens- und/oder Personenstandsänderung im Heimatstaat des Ausländers Gültigkeit haben, sofern es keine entsprechenden Vereinbarungen gibt.
Das Verfahren kann zudem durch die Prüfung, ob das Heimatrecht des „Ausländers“ keine vergleichbare Regelung kennt, durchaus erheblich verzögert werden. Zudem ist nicht immer klar, was eine dem TSG vergleichbare Regelung ist. Hier hätte der Gesetzgeber das TSG generell für Ausländer öffnen sollen.
cc) Beteiligte: Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 TSG ist die Beteiligung des Vertreter des öffentlichen Interesses (VÖI) vorgesehen. Dieser vertritt die Interessen des Landes bzw. von Landesbehörden bei Verfahren nach dem TSG. Die Befürchtung des Gesetzgebers war, dass das Verfahren missbräuchlich in Anspruch genommen werden könnte. In der Praxis ist uneinheitlich geregelt, welche Behörde eigeschaltet werden muss (beispielsweise der Regierungspräsident oder die Staatsanwaltschaft). Die Beteiligung des VÖI führt zurzeit noch zu einer nicht unerheblichen Verzögerung des Verfahrens, bei einer Reform des TSG würde sie deswegen aller Wahrscheinlichkeit nach gestrichen ( Vgl. BTag-Innenausschuss 2007 Protokoll Nr. 16/31 S. 23 f., wo die Vertreter des BMI und die Innenministerien der Länder den Verzicht auf den VÖI ebenfalls befürworten).
dd) Auch Intersexuelle können das TSG in Anspruch nehmen. Medizinisch ist Intersexualität ein Ausschlusskriterium, das hat allerdings keine Bedeutung für das rechtliche Verfahren. Hier spricht das Gesetz nur davon, dass die transsexuelle Person sich nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig fühlt.
Das TSG schließt als Spezialgesetz die Anwendbarkeit des Namensänderungsgesetzes (NamÄndG) aus.
b) Vornamensänderung und Personenstandsänderung:
a) Am 11. Januar 2011 hat das BVerfG (1 BvR 3295/07) entschieden, dass die in § 8 Abs. 1 Nr. 3 & 4 Transsexuellengesetz (TSG) geforderte geschlechtsangleichende Operation und Sterilisation gegen den eigenen Willen des/der Transsexuellen eine nicht gerechtfertigte Verletzung der Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und körperliche Selbstbestimmung (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs.1 GG) darstellt.
Die Folge der Entscheidung ist, dass die Voraussetzungen für Namensänderung und Personenstandsänderung zurzeit identisch sind. Dies wurde durch eine erneute Entscheidung des BVerfG (1 BvR 2027/11) bestätigt.
Mit der Vornamensänderung sollte man gleichzeitig die Personenstandsänderung beantragen.Eine Verbindung nach § 9 TSG ist dann nicht mehr erforderlich.
Die Voraussetzungen der Vornamensänderung findet man in § 1 TSG. Vornamen können auf Antrag vom dem zuständigen Gericht geändert werden, wenn die betroffene Person folgende Voraussetzung erfüllt:
Sie muss sich auf Grund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfinden
und
seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang stehen, ihren Vorstellungen entsprechend leben zu müssen.
Schon der Wortlaut der Vorschrift gibt her, dass dies nicht bedeutet, seit drei Jahren in der entsprechenden Rolle auch gelebt haben zu müssen (so aber falsch z.B. Heinrichs/ Ellenberger in Palandt BGB Kommentar 67. Auflage 2008 § 1 Rn. 12). Zuweilen wird dieses sowohl von Gerichten als auch von Gutachtern offensichtlich zu Unrecht gefordert.
b) Vom Gericht werden zwei unabhängig voneinander tätige Sachverständige beauftragt, die auf Grund ihrer Ausbildung und beruflichen Erfahrung mit den Problemen der Transsexualität ausreichend vertraut sind. Diese müssen in ihren Gutachten auch dazu Stellung nehmen, wie gefestigt nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das Zugehörigkeitsempfinden der Betroffenen zu dem „anderen Geschlecht“ ist; die Vornamensänderung darf nur erfolgen, wenn es sich das Zugehörigkeitsempfinden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern wird. Entscheidend für die Beurteilung ist die Meinungsbildung des Gerichts, das sich – zumindest theoretisch – auch über die Gutachten der Sachverständigen hinwegsetzen könnte.
c) Wirkungen der Vornamensänderung:
Die Vornamensänderung allein (!) hat keinen Einfluss auf die rechtliche Geschlechtszuordnun. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag im Reisepass dem Vornamen entsprechend anzupassen. Die „kleine Lösung“ ermöglicht das Auftreten im Rechtsverkehr als dem anderen Geschlecht zugehörig. Weitere geschlechtsspezifische Rechte, wie beispielsweise, ob man eine Ehe oder eine Eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen darf, kann man daraus nicht ableiten. Hierin könnte also ein Grund liegen, ob man mit der Vornamensänderung gleichzeitig die Persoenstandsänderung beantragt oder nicht.
Der Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde wird dementsprechend nur bei der Vornamensänderung auch nicht geändert. Auf Antrag können Transsexuelle aber eine Geburtsurkunde auch ohne Geschlechtsvermerk ausgestellt bekommen, so § 59 PStG.
Die Wirkungen der Vornamensänderung sind in rechtlicher Hinsicht weniger „dramatisch“, als es den Anschein hat. Denn bereits vor Rechtskraft der Namensänderung ist das Auftreten in der neuen Identität durchaus zulässig, sei es mündlich, schriftlich, privat oder behördlich. Sofern keine Täuschungsabsicht besteht, ist demzufolge auch vor der Vornamensänderung ein soziales Leben mit dem neuen Namen unter gewissen Einschränkungen möglich. Dies ergibt sich daraus, dass Vorname und Geschlecht in der Regel für die überwiegende Zahl der gesellschaftlichen Vorgänge rechtlich nicht erheblich sind. Ganz anders im sozialen Bereich, hier ist der Name Ausdruck der persönlichen Identität. Rechtlich spielt es allerdings keine Rolle, ob ein “Herr” oder eine “Frau” Schmidt einen Kaufvertrag schließt.
Eine wichtige Ausnahme ist allerdings die Führung eines Bankkontos (§ 154 AO); hier muss der “amtliche” Vorname angegeben werden. Problematisch kann es auch immer dann werden, wenn man sich ausweisen und seine Identität nachweisen muß, z.B. bei Polizeikontrollen oder bei Zahlungen mit der Kredit- oder EC-Karte, die auf den “amtlichen” Namen ausgestellt sind. Bei Zustellungsverzögerungen, z. B. von Mahnungen, Rechnungen oder gerichtlichen Aufforderungen und Ladungen, kann es unter Umständen auch zu Schadensersatzansprüchen kommen, wenn mit dem “nicht amtlichen” Namen agiert wurde.
Obwohl Behörden, Institutionen und Privatpersonen den neuen Namen bereits verwenden können, gibt es einen durchsetzbaren Rechtsanspruch erst nach der Namensänderung; so kann z.B. die dem neuen Vornamen entsprechende Anrede „Herr“ oder „Frau“ erst nach erfolgter Änderung durchgesetzt werden. Nach rechtskräftigem Beschluss über die Vornamensänderung wird beim Sozialversicherungsausweis die Kennzahl der Sozialversicherungsnummer geändert und dem Namen angepasst, man erhält eine neue Rentenversicherungsnummer, auch Ausweispapiere und der KfZ-Schein/ -Brief müssen geändert werden, die übrigen Dokumente können und sollten geändert werden. Nach der Vornamensänderung besteht einen Anspruch darauf Zeugnisse auf den neuen Namen ändern zu lassen.
d) Personenstandsänderung
Beantragt man gleichzeitig mit oder nach der Namensänderung die Personenstandsänderung, so hat dies zur Folge, dass man auch personenstandsrechtlich als dem anderen Geschlecht zugehörig angesehen wird. Eine bestehende Ehe oder Lebenspartnerschaft wird nicht tagiert. Probleme stellen sich allerdings, wenn man beispielsweise eine eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe "umwandeln" will.
e) Problemfelder:
aa) Eine eingetragenen Lebenspartnerschaft steht einer Personenstandsänderung nach § 8 I TSG nicht im Wege. Das TSG umreißt den verfassungsrechtlichen Rahmen für die grundrechtsentfaltung transsexueller Personen. Das BVerfG (1 BvL 10/05) hat in seiner Entscheidung vom 27. Mai 2008 klargestellt, dass § 8 Abs. 1 Nr. 2 TSG mit Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 6 Abs. 1 GG nicht vereinbar ist. Die personenstandsrechtliche Anerkennung der neuen Geschlechtszugehörigkeit darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass die Ehe eines verheirateten Transsexuellen zuvor geschieden wird. Da wegen des Grundsatzes des Vorbehalts des Gesetzes jede belastende staatliche Maßahme einer gesetzlichen Grundlage (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) bedarf wäre eine Auflösung der Lebenspartnerschaft über die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten hinaus wegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ohne gesetzliche Regelung auch nicht möglich. Entsprechende Regelungen gibt es nicht. Die Existenz einer eingetragenen Lebenspartnerschaft steht einer personenstandsrechtlichen Änderung nach § 8 TSG nicht entgegen.
Eine Änderung der Geschlechtszugehörigkeit hat keine Beendigung der Lebenspartnerschaft zur Folge. Problematisch ist aber, dass eine Auflösung der Lebenspartnerschaft gar nicht erfolgen kann, da im vorliegenden Fall kein Auflösungsgrund gemäß § 15 Abs. 2 LPartG vorliegt. Die Partner wollen ihre Partnerschaft ja nicht trennen, sondern sie wollen gerade heiraten. In diesem Zusammenhang wäre das Fingieren eines Trennungswillens nicht zumutbar.
Hinzu kommt, dass die Eheverbote abschließend in §§ 1306 ff BGB geregelt sind. Zwar handelt es sich bei Lebenspartnerschaft und Ehe um Rechtsinstitute mit ähnlicher Ausrichtung, jedoch trifft § 1306 BGB eine eindeutige Regelung. Danach kommt eine eingetragene Lebenspartnerschaft als Ehehindernis nur dann in Betracht, wenn zwischen einer der Personen, welche eine Ehe begründen wollen, und einer dritten Person eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft besteht. Bei verpartnerten Menschen ist dies aber nicht der Fall, sodass eine eingegangene eingetragene Lebenspartnerschaft bereits dem Wortlaut nach nicht vom Anwendungsbereich des § 1306 BGB erfasst wird. Für eine analoge Anwendung des § 1306 BGB ist kein Raum, denn der Gesetzgeber hat im Zuge der Reform des Lebenspartnerschaftsgesetzes die geltende Regelung bewusst gewählt (vgl hierzu Palandt Brudermüller LPartG § 1 Rn 6, BVerfG NJW 2002, 2543, 2547 m.w.N.).
Die Frage, ob eine eingetragene Lebenspartnerschaft mit dem Eingehen der Ehe aufgelöst, wird allerdings nicht beantwortet, sie kann allerdings dahinstehen. Dies fällt in die Zuständigkeit des Gesetzgebers fallen. Eine eingetragene Lebenspartnerschaft zwischen denselben eheschließungswilligen Personen berechtigt daher den Standesbeamten nicht zur Feststellung eines Ehehindernisses (vgl. dazu auch LG Berlin Beschluss vom 21. Januar 2008 84 T 380/07).
bb) Ein weiteres nicht unbedeutendes Problem ist die Tatsache, dass es durch die Entscheidung des BVerfG vom 11. Januar 2011 mehr Transsexuelle geben wird, die ihren Personenstand geändert haben ohne sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen zu haben.
Die große Lösung sichert ab Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung über die Personenstandsänderung die volle Rechtsstellung im neuen Geschlecht als Frau oder Mann, bei Eheschließung, Rente, Berufstätigkeit usw. (§ 10 Abs. 1 TSG). Die Herausforderung die sich nun für den Staat und die Gesellschaft stellt, ist wie man mit den bei der kleinen Lösung auftretenden Problemfeldern umgeht. Zu denken sind an Probleme mit Arbeitsschutzbestimmungen für Frauen oder wenn eine unoperierte transsexuelle Person eine Freiheitsstrafe verbüßen muss. Auch im Krankenhaus und bei der Toilettenbenutzung kann es Schwierigkeiten geben.
2. Arbeitsrecht
Besonders im Arbeitsrecht gibt es Probleme (im Zusammenhang mit dem Offenbarungsverbot, §§ 5, 10 Abs. 2 TSG). Ab rechtskräftiger Entscheidung über Vornamens- und/oder Personenstandsänderung dürfen die zur Zeit der Entscheidung geführten Vornamen ohne Zustimmung der betreffenden Person nicht offenbart oder ausgeforscht werden, es sei denn, dass besondere Gründe des öffentlichen Interesses dies erfordern oder ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Daraus leitet man auch ab, dass Zeugnisse, Bescheinigungen, arbeitsrechtliche Papiere usw. auf den neuen Namen abzuändern sind, was in der Praxis oftmals Probleme bereitet, sei es, dass der Arbeitgeber nicht mehr existiert, sei es dass er sich weigert die Zeugnisse umzuschreiben. Schließlich gibt es massive Probleme im Zusammenhang mit Kündigung oder Mobbing aufgrund von Transsexualität.
a) Zugang zum Arbeitsmarkt
Probleme gibt es beim Zugang zum Arbeitsmarkt. Hier kann man zwischen formellen Hindernissen (die auf Grund von Gesetzen, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften bestehen so z.B. die die PDV 300) und informellen Hindernissen (die nicht auf einer geltenden Vorschrift basieren, sondern auf diskriminierendes Handeln von Verantwortlichen in der Arbeitsvermittlung oder von Personalverantwortlichen zurückzuführen sind). Transsexuelle gelten bei den Arbeitsagenturen und privaten Arbeitsvermittlungen generell als nicht oder schwer vermittelbar.
aa) Das Bundesarbeitsgerichts hat zudem entschieden, dass Transsexuelle – auch nur mit der kleinen Lösung! – nicht verpflichtet sind sich bei Vorstellungsgesprächen zu outen. Der Arbeitgeber kann also den Arbeitsvertrag nicht wegen arglistiger Täuschung über das Geschlecht anfechten, auch dann, wenn das Geschlecht für die angestrebte Tätigkeit wesentlich ist.
bb) Auch vor der Vornamensänderung besteht ein Rechtsanspruch auf die Arbeitskleidung des neuen Geschlechtes. Dies ist kein Kündigungsgrund. Das Landesarbeitsgericht Berlin hat die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in einem Grundsatzurteil dazu verurteilt, dem „Kläger“ (einer Mann-zu-Frau-Transsexuellen) weibliche Dienstkleidung als Busfahrerin zur Verfügung zu stellen.
b) Informelle Hindernisse
Informellen Hindernisse sind auch während der Erwerbstätigkeit von Bedeutung. Mobbing, negative Zuschreibungen und Vorurteile sind Belastungen, welche zu psychischen Problemen führen können und letztlich die Entwicklung der Potentiale der Beschäftigten einschränken. Es kommt vor, dass Transsexuelle in solchen Tätigkeitsbereichen nicht (mehr) eingesetzt werden, die mit Kundenverkehr verbunden sind. Darüber hinaus kann es innerbetriebliche Anforderungen geben, die zu einer systematischen Benachteiligung von Transsexuellen führen.
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nimmt Transsexuelle ausdrücklich in seinen Schutzbereich auf. Probleme treten hier gehäuft im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht auf (siehe oben).
Auch in anderen Lebensbereichen haben TS mit „AGG-relevanten“ Diskriminierungen oder Belästigungen zu rechnen. Die wichtigsten sind das Wohnumfeld, das Bildungs-, Gesundheits- und Versicherungswesen und nicht zuletzt der Freizeitbereich. Problematisch ist im Zusammenhang mit dem AGG vor allem die kurze Frist Ansprüche geltend zu machen. Sie beträgt 2 Monate.
3. Krankenkassen
Die Schwäche des derzeitigen TSG liegt auch darin, dass es eine ungute, da in sich nicht schlüssige Verknüpfung von medizinischen und rechtlichen Fragen enthält.
Derzeit wird für die Vornamensänderung durch fachmedizinische Gutachten die Transsexualität „festgestellt“; auch aufgrund rechtlicher Vorgaben reicht dies aber in vielen Fällen den Krankenkassen für die Gewährung geschlechtsangleichender Maßnahmen, wie Hormongabe, Epilation etc. nicht aus. Denn, um diese Leistungen in Anspruch nehmen zu können, wird, neben weiteren Voraussetzungen, der Nachweis eines entsprechenden Leidensdrucks gefordert; die Gutachten für das gerichtliche Verfahren sagen darüber in der Regel nichts aus. Nun ist es äußerst weltfremd, einen solchen Leidensdruck nicht als bereits durch die Diagnose der Transsexualität indiziert zu sehen. Dennoch verweigern immer mehr Krankenkassen die Übernahme der Kosten für die geschlechtsangleichenden Maßnahmen (z.B. Epilation, Hormongabe, Brustaufbau, GAOP usw.) mit genau dieser Argumentation.
Die Befürchtungen vieler Betroffener, dass sich die Krankenkassen immer weiter ihrer Leistungsverpflichtung entziehen werden, sollte sehr ernst genommen werden. Diese Tendenzen gibt es bereits. Die Kassen wurden grundsätzlich dazu verpflichtet die Kosten für geschlechtsangleichende Maßnahmen zu übernehmen. Es sollte auch gesetzlich sichergestellt werden, dass sie bei Vorliegen der Diagnose Transsexualität sämtliche zur Geschlechtsangleichung erforderlichen Kosten tragen zu müssen. Die Sachbearbeiter sollten stärker über die TS-Problematik informiert sein.
Die Behandlung von TS liegt im Verantwortungsbereich des Arztes. Dieser kann nicht dazu gezwungen werden eine bestimmte Behandlung, wie z.B. Hormongabe zu verschreiben. Umgekehrt dürfen die Kassen die Genehmigung geschlechtsangleichender Maßnahmen nicht von der Durchführung des TSG-Verfahrens abhängig machen.
a) gesetzliche Kassen:
Zurzeit gibt es speziell bei Kostenübernahme der Epilationsbehandlung Probleme. Dieser besteht grundsätzlich und unbestritten aus § 27 Abs. 1 Satz 1 u. 2 SGB V . Demnach steht TS ein Anspruch auf die notwendige Krankenbehandlung zu. Die vorhandene Gesichtsbehaarung stellt im Zusammenhang mit MzF-Transsexualität eine Krankheit im Sinne dieser Vorschrift dar (vgl. dazu den Beschluss des BSG vom 20.06.2005 - B 1 KR 28/04 B und das Urteil des BSG vom 06.08.1987 - 3 RK 15/86 = SozR 2200 § 182 Nr. 106). Dies wird dem Grund nach von den Kassen auch nicht bestritten.
Problematisch ist, dass kein Mediziner die von den Kassen zu leistende Behandlung „Nadelepilation“ übernehmen kann. Zum einen, weil die meisten Mediziner nur noch Laserbehandlungen durchführen, die bei hellen Haaren wirkungslos sind, nicht zu dem Maßnahmenkatalog der gesetzlichen Kassen zählen und aufgrund des Abrechnungsmodus wirtschaftlich für keinen Mediziner interessant sind, sodass diese die Leistung gar nicht anbieten. Selbst wenn eine Behandlung durch einen Mediziner erfolgen könnte, so würde diese aber unangemessen lange dauern.
Massive Probleme gibt es auch bei der Kostenübernahme für einen Brustaufbau, da hier als Maßstab „biologische Frauen“ genommen werden, was aber nicht angemessen ist.
Genau das ist aber die entscheidende Frage.
Auch die Rechtsprechung des BSG ist hier nicht zielführend, denn dort geht es definitiv um kosmetische Korrekturen. Sowohl das BSG für die gesetzlichen Kassen, der BGH für die privaten Kassen als auch das BVerfG sind allerdings einstimmig der Ansicht, dass Transsexualität eine besondere Betrachtungsweise erfordert.
Bei Transsexualität verhält es sich daher anders. Im vorliegenden Fall geht es darum, dass die geschlechtsangleichenden Maßnahmen bei der Klägerin nicht zu einem ausreichenden Brustwachstum führten.
Die von den MDKs häufig verwendete Argumentation mit der funktionellen Beeinträchtigung lässt jede Kenntnis des Problembereichs Transsexualität vermissen. Gerade bei Transsexualität wird in einen eigentlich gesunden Körper eingegriffen, ohne dass eine entsprechende „Funktionsstörung“ vorliegt. So zum Beispiel auch bei der geschlechtsangleichenden (Genital-) Operation. Mit der Argumentation der MDKs und somit der Kassen, dass die Leistungspflicht der gesetzlichen Kassen nicht „die Kosten für den operativen Eingriff in einen regelgerechten Körperzustand“ umfasse ließe sich also jede geschlechtsangleichende Operation ablehnen.
Hier werden also unzulässigerweise zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche vermischt, so im übrigen auch das LSG Berlin-Brandenburg (L 1 KR 243/09), zutreffend hingegen SG Wiesbaden (S 1 KR 89/08).
Auch das SG Aachen (S 13 KR 100/09) ist in seiner Argumentation weder logisch noch konsequent. Wenn es denn so wäre, dass „... die bei der KIägerin bestehende Mikromastie schon deshalb nicht als behandlungsbedürftige Krankheit bewertet werden kann, weil damit keine körperliche Fehlfunktion verbunden ist. Allein das fehlende Fettgewebe macht den Zustand der Brüste nicht zu einem krankhaften...“ so wäre eine Genital-OP ebenfalls niemals zu genehmigen. Einen Rückgriff auf eine Entstellung bedarf es ebensowenig.
Solange sich kein ausreichendes Brustwachstum entwickelt hat gehört der Brustaufbau zu den geschlechtsangleichenden Maßnahmen, der sich allein nach den Grundsätzen beurteilen lässt, ob es zu einer entsprechenden ausreichenden Brustentwicklung gekommen ist oder nicht.
Ebensowenig können geschlechtsangleichende Maßnahmen zur Behandlung der Transsexualität auch nicht mit dem Argument (dem Vorrang) der Psychotherapie abgelehnt werden. Hierbei wird verkannt, dass es sich bei Transsexualität eben um eine spezielle „Erkrankung“ handelt, die eben darauf zielt den Körper zu verändern, dem anderen Geschlecht anzugleichen. Das oben gesagte gilt entsprechend auch hier.
Bei FzM kann die Mastektomie spiegelbildlich problematisch sein. Nämlich dann, wenn noch Brustgewebe da ist, also die OP nicht vollständig erfolgreich war. Dann versuchen sich die Kassen ebenfalls ihrer Leistungspflicht zu entziehen, indem sie wieder die "kosmetische Karte" ziehen. Hier hat das SG Wiesbaden nun eine richtige Entscheidung getroffen (S 1 KR 89/08). Hier argumentierte die Kasse eine erneute OP zur vollständigen Entfernung der Brust sei eine rein kosmetische Angelegenheit, wofür die gesetzliche Krankenversicherung nicht zuständig sei. Das Sozialgericht war allerdings der zutreffenden Ansicht, dass dieses Argument hier nicht greift, denn die Krankenkasse habe einer operativen Angleichung an den männlichen Oberkörper zugestimmt. Dieses Ziel sei aber offenbar noch nicht richtig erreicht worden. Daher müsse die Kasse auch für notwendige Korrekturen aufkommen.
"Transsexuelle wollen nach den gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft ihr Geschlecht nicht manipulieren. Im Vordergrund steht für sie nicht die Sexualität, sondern das Streben nach der Einstimmigkeit von Psyche und Physis, so dass die Operation als Teil der Verwirklichung dieses Ziel anzusehen ist." (BVerfGE 49, 268)
„Wenn denn vor diesem Hintergrund die Beklagte anerkannt hatte, dass der Kläger die Kriterien für eine geschlechtsangleichende Operation erfüllt, muss sie nach Überzeugung des erkennenden Gerichtes auch die Konsequenzen tragen und für die Fälle, dass die Geschlechtsangleichung noch nicht zufriedenstellend erfolgt ist, eine Kostenübernahme für eine Korrekturoperation bewilligen.“, so SG Wiesbaden (S 1 KR 89/08).
Schließlich ist bei FzM-Transsexuellen die Kostenübernahme eines Penoidaufbau problematisch.
b) private Kassen:
Seit des Beschlusses des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 08.03.95 (IV ZR 153/94) ist grundsätzlich festgestellt, dass die privaten Krankenkassen zur Kostenübernahme der geschlechtsangleichenden Maßnahmen verpflichtet sind.
Auch bei den privaten Kassen gibt es Schwierigkeiten. Hier sollte man sich vor Augen halten, dass die privaten Krankenkassen die Möglichkeit haben, sich durch Rücktritt, Kündigung und Anfechtung vom Versicherungsvertrag zu lösen oder allgemein bestimmte Leistungen auch ablehnen können.
Probleme können entstehen, wenn man sich bereits vor dem Vertragsabschluß wegen Transsexualität ärztlich behandeln ließ oder die Transsexualität beim Vertragsabschlusses nicht angegeben hatte. Hier ist es also wichtig darzulegen, das die Transsexualität beim Vertragsabschlusses nicht angegeben werden konnte, weil man sich derer nicht bewusst war.
Bei Fällen in denen sich Probleme mit den Kassen – ob gesetzlich oder privat – abzeichnen ist es angebracht sich früh um anwaltliche Hilfe zu kümmern. Dies ist besonders bei den zivilgerichtlichen Verfahren zu beachten, da hier ein wesentlich höheres Kostenrisiko besteht.
Der LSVD bietet im Rahmen seiner Rechtsberatung ein erstes Orientierungsgespräch an.
4.Weitere Rechtsgebiete
Weitere Schwierigkeiten liegen im z. B. im Familienrecht, wenn es um Scheidung, Umgangsrecht und Unterhalt geht. Hier gibt es vor allem bei Gerichten unausgesprochene Vorurteile gegen einen transsexuellen Elternteil.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass unser Recht zwar selbstverständlich von der Einteilung in zwei Geschlechter ausgeht, aber juristisch nicht eindeutig definiert ist was als männlich oder weiblich zu gelten hat, wie das Geschlecht zu bestimmen ist und wer diese Kriterien festlegt. Die Vorstellungen darüber verschwimmen immer mehr, sodass eine ausschließlich biologisch begründete Normierung problematisch geworden ist.
Viel zu oft haben Transsexuelle mit Vornamensänderung (§ 1 TSG) darunter zu leiden, dass sie nicht entsprechend der geschlechtlichen Konnotation ihres Vornamens, sondern entsprechend ihrem – unveränderten – Personenstand angesprochen/angeschrieben werden. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings (zuletzt 2011) festgestellt, dass „eine Person bereits nach Änderung ihres Namens entsprechend dem neuen Rollenverständnis anzureden und anzuschreiben ist“, jedoch ist diese Entscheidung selbst bei Behörden nicht immer bekannt. So werden beispielsweise Wahlbenachrichtigungen oder Steuerbescheide falsch adressiert.
Dies gilt im Übrigen für alle Lebensbereiche, für private Institutionen ebenso, wie für Behörden. Auch der Hinweis, dass es "computertechnisch" nicht möglich sei ist nicht zulässig. Es muss sichergestellt sein, dass die korrekte Anrede verwenet wird, nötigenfalls muss die eben handschriftlich korrigiert werden.
Andere Probleme, vor allem im privaten Bereich, lassen sich nicht so leicht lösen. Selbst bei Beleidigungen wird die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen und auf den Privatklageweg verweisen. In den allermeisten Fällen führt das Verfahren nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Im Anwendungsbereich des AGG kann sich etwas anderes ergeben, z.B., wenn der Zugang zu einer Disko oder einem Restaurant etc. verweigert wird. Hier kommt es immer auf die Umstände des Einzelfalles an. Da das AGG aber eine Beweislastumkehr beinhaltet, reicht schon der Anschein einer möglichen Diskriminierung aus. Hier wird sich allerdings erst in der Zukunft zeigen, wie die Gerichte mit den AGG-Fällen umgehen.
Datenschutzrechtliche Fragen ergeben sich durch die neu eingeführte Steueridentifikationsnummer. Hier wird das Geburtsgeschlecht permanent eingetragen, ohne Möglichkeit einer nachträglichen Korrektuer oder wenigstens einer Ergänzung. Dies hebelt das im TSG zugesicherte Offenbarungsverbot weitgehend aus.